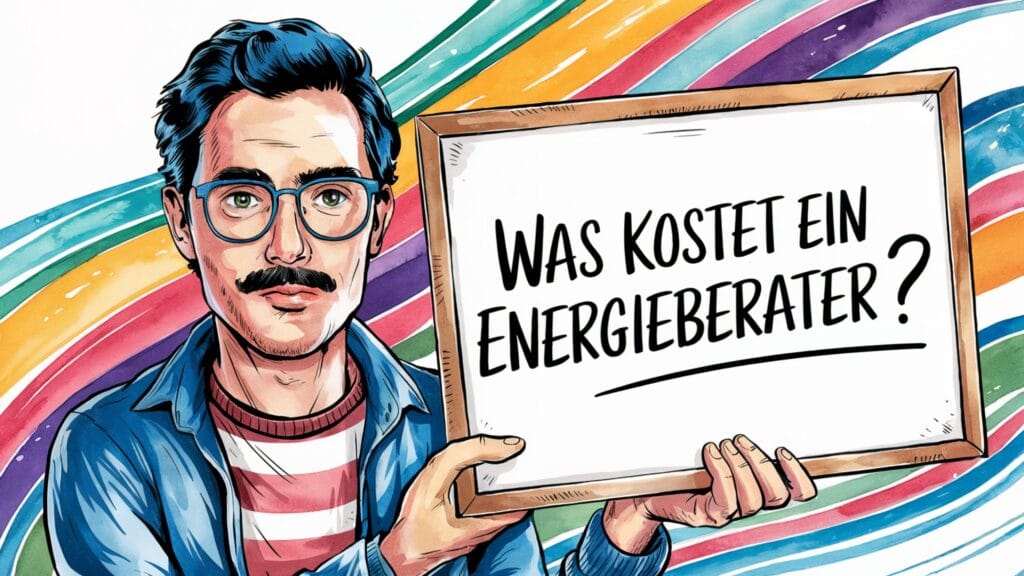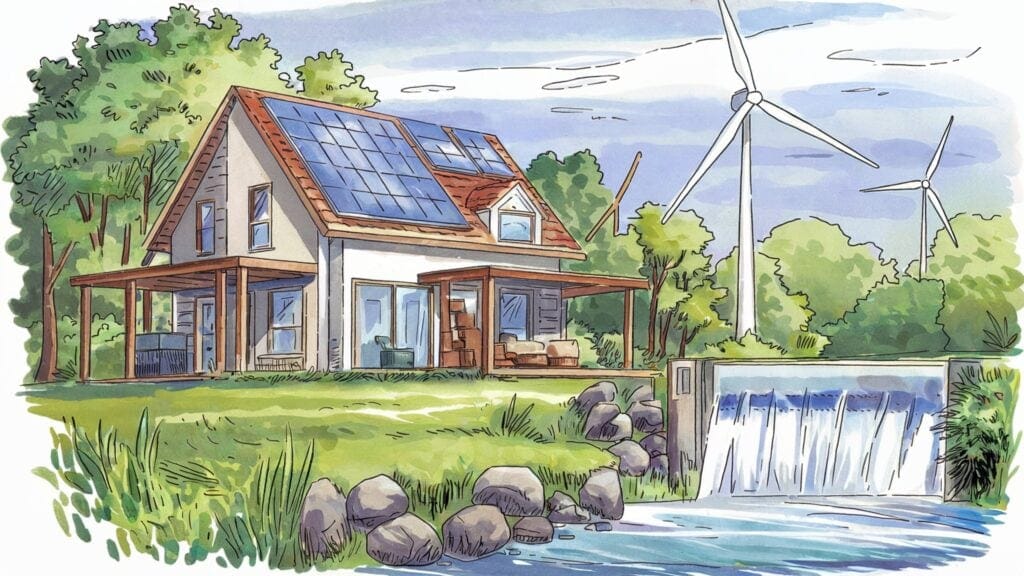Energieausweis berechnen und verstehen -> Heizkosten senken

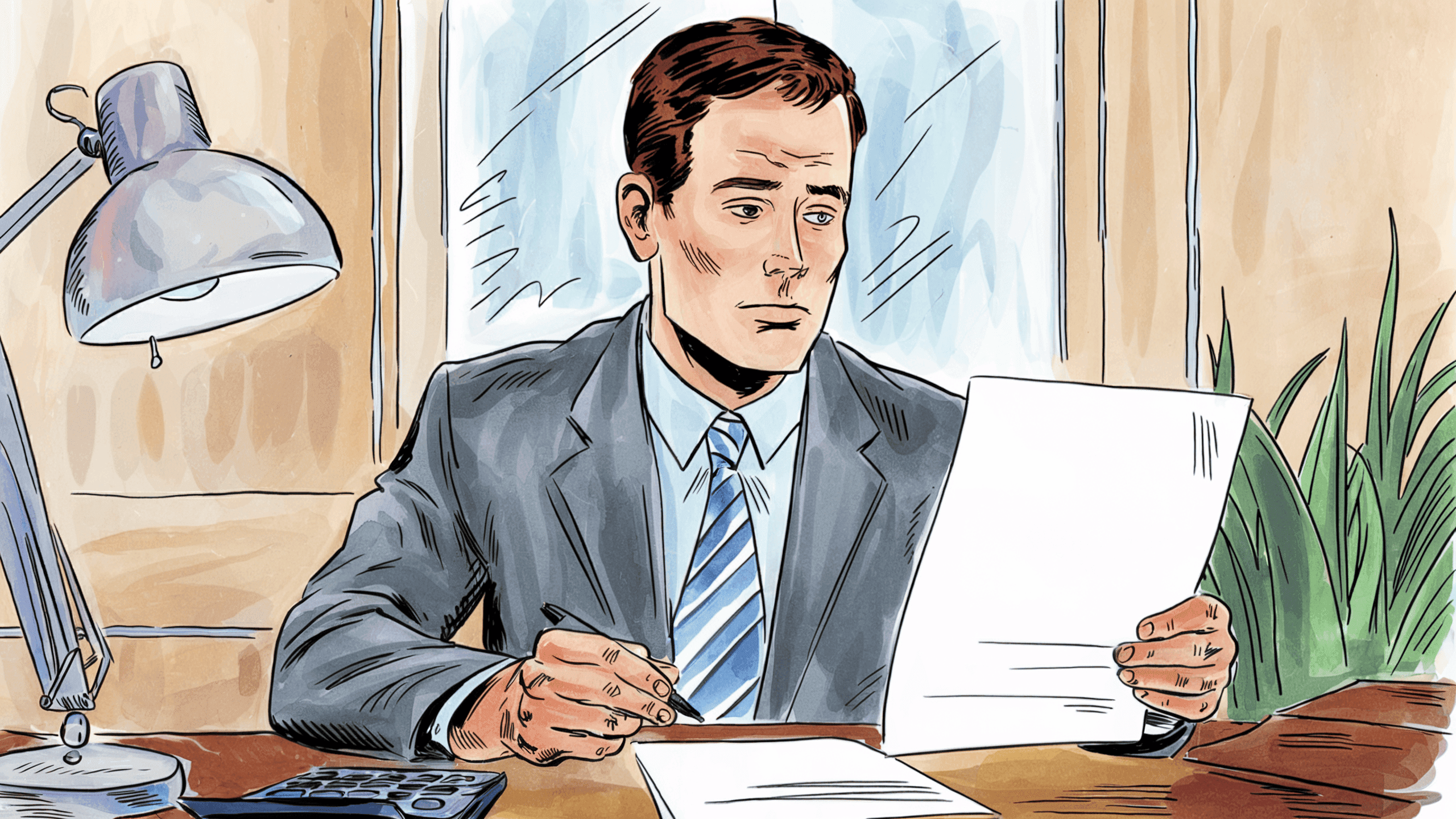
Der Energieausweis ist ein wichtiges Dokument für Immobilienbesitzer und Mieter, da er Auskunft über den Energieverbrauch oder -bedarf eines Gebäudes gibt. Mit ihm können Sie den energetischen Zustand Ihrer Immobilie bewerten und konkrete Heizkosten pro Quadratmeter abschätzen.
Seit Einführung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als Nachfolger der Energieeinsparverordnung (EnEV) gibt es klare Vorgaben, wie der Endenergieverbrauch zu berechnen ist. Die Berechnung unterscheidet zwischen Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis, wobei ersterer die tatsächlichen Verbrauchsdaten der letzten drei Jahre berücksichtigt, während der Bedarfsausweis den theoretischen Energiebedarf anhand von Baujahr, Wohnfläche und Gebäudehülle ermittelt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem richtigen Energieausweis nicht nur Ihre gesetzlichen Pflichten erfüllen, sondern auch Einsparpotenziale bei den Energiekosten identifizieren und durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen Ihre Energieeffizienzklasse verbessern können.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: Der Verbrauchsausweis basiert auf dem tatsächlichen Energieverbrauch der letzten drei Jahre, während der Bedarfsausweis eine theoretische Berechnung anhand von Gebäudedaten darstellt.
- Für den Verbrauchsausweis müssen mindestens 36 Monate Verbrauchsdaten vorliegen, die klimabereinigt werden. Der Bedarfsausweis berücksichtigt dagegen Gebäudeinformationen wie Baujahr, Wärmedämmung und Heizungsart.
- Der Energieausweis enthält wichtige Kennwerte wie Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf, CO2-Emissionen und die Energieeffizienzklasse (A++ bis G), die zur schnellen Orientierung dient.
- Die Gültigkeit eines Energieausweises beträgt zehn Jahre. Nach energetischen Sanierungen oder wesentlichen Änderungen am Gebäude ist eine Neuerstellung erforderlich.
- Anhand des Energieausweises können Heizkosten pro Quadratmeter abgeschätzt und geeignete Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung identifiziert werden.
Grundlagen zur Berechnung des Energieausweises für Wohngebäude
Die Berechnung eines Energieausweises ist kein Hexenwerk! Als Energieberater stoße ich immer wieder auf Unsicherheiten, wenn es darum geht, wie man eigentlich einen Energieausweis berechnet. Dabei ist dieses Dokument mehr als nur ein buntes Stück Papier – es zeigt den energetischen Zustand Ihres Gebäudes und hilft, Heizkosten zu senken.
Ein Energieausweis liefert wichtige Informationen zum Energieverbrauch oder -bedarf eines Wohngebäudes und klassifiziert die Immobilie nach ihrer Energieeffizienz. Seit Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – dem Nachfolger der Energieeinsparverordnung (EnEV) – gibt’s klare Regeln, wann und wie dieser Ausweis erstellt werden muss.
Wer eine Immobilie verkaufen, vermieten oder neu bauen möchte, kommt um den Energieausweis nicht herum. Er dient potenzielle Mieter oder Käufer als Orientierungshilfe und macht die Energiekosten transparenter.
Energieverbrauch und Energiebedarf: Unterschiede
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Energieverbrauch und Energiebedarf? Diese Frage höre ich oft in meinen Beratungsgesprächen.
Der Energieverbrauch bezieht sich auf den tatsächlichen Energieverbrauch eines Gebäudes, der aus Abrechnungen der letzten drei Jahre ermittelt wird. Er hängt stark vom Heizverhalten der Bewohner ab. Ein sparsamer Bewohner könnte selbst in einem weniger effizienten Haus einen geringeren Verbrauch erzielen als ein verschwenderischer in einem top-gedämmten Neubau.
Der Energiebedarf hingegen wird theoretisch berechnet und stellt den zu erwartenden Energiebedarf des Gebäudes unter Standardbedingungen dar. Hier spielen die Bausubstanz und der Heizungsanlage die Hauptrolle. Diese Berechnung erfolgt unabhängig vom individuellen Nutzungsverhalten.
Ich hatte mal einen Kunden mit einer Immobilie aus den 60er Jahren. Sein Verbrauchsausweis zeigte überraschend gute Werte. Als wir dann den Bedarfsausweis erstellten, kam die Wahrheit ans Licht: Er heizte kaum, trug lieber dicke Pullover! Der Bedarfsausweis offenbarte den wahren energetischen Zustand des Hauses.
Relevante Gebäudedaten für die Berechnung
Für die Berechnung des Energieausweises benötigen Sie folgende Gebäudedaten:
- Baujahr des Gebäudes
- Wohnfläche oder Gebäudenutzfläche
- Art und Alter der Heizungsanlage
- Informationen zur Dämmung (Dach, Wände, Keller)
- Art der Fenster und Verglasung
- Angaben zur Lüftung
- Energieträger für Heizung und Warmwasserbereitung
Bei älteren Gebäuden, die vor 1977 gebaut wurden, ist die Datenlage oft dünner. Hier müssen manchmal Standardwerte angenommen werden, was die Genauigkeit der Berechnung beeinträchtigen kann.
Die Wohnfläche wird übrigens mit dem Faktor 1,2 oder 1,35 multipliziert, um die Gebäudenutzfläche zu ermitteln, da auch Treppenhaus und Kellerräume anteilig in die Energiebilanz einfließen.
Verbrauchs- oder Bedarfsausweis: Welcher passt zu Ihrem Gebäude?
Wenn’s um Energieausweise geht, stehen Eigentümer immer wieder vor der Frage: Verbrauchs- oder Bedarfsausweis? Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab.
Der Verbrauchsausweis basiert auf dem tatsächlichen Energieverbrauch der letzten drei Jahre. Er ist meist günstiger und schneller zu erstellen. Der Bedarfsausweis hingegen erfolgt auf Basis einer technischen Analyse des Gebäudes und ist unabhängig vom Nutzerverhalten.
Manchmal hab ich’s erlebt, dass Eigentümer bewusst den Verbrauchsausweis wählen, um bessere Werte zu erzielen – besonders bei alten, aber sparsam genutzten Gebäuden. Doch Vorsicht: Das kann bei einem Verkauf schnell nach hinten losgehen, wenn der neue Eigentümer normal heizt!
Kriterien für die Wahl des richtigen Energieausweises
Ihre Entscheidung zwischen Verbrauchs- oder Bedarfsausweis sollte auf folgenden Kriterien basieren:
- Gesetzliche Vorgaben: In manchen Fällen ist die Wahl nicht frei, sondern gesetzlich vorgeschrieben.
- Gebäudegröße: Bei Gebäuden mit weniger als 5 Wohneinheiten ist oft ein Bedarfsausweis erforderlich.
- Baujahr: Für Gebäude, die vor 1977 gebaut wurden und nicht energetisch saniert wurden, ist ein Bedarfsausweis Pflicht.
- Datenverfügbarkeit: Liegen keine Verbrauchsdaten für drei aufeinanderfolgende Jahre vor, bleibt nur der Bedarfsausweis.
- Verwendungszweck: Für Modernisierungsempfehlungen ist der Bedarfsausweis aussagekräftiger.
Der Verbrauchsausweis gibt den Verbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter an. Beim Bedarfsausweis wird der theoretische Energiebedarf berechnet – hier ist die Angabe in Kilowattstunde pro Quadratmeter Nutzfläche der Standard.
Gesetzliche Vorgaben nach GEG und EnEV
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das 2020 die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst hat, gibt klare Regeln vor, wann welcher Energieausweis erstellt werden muss. Es vereint das Energieeinsparungsgesetz, die EnEV und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz.
Nach dem GEG ist für Wohngebäude mit bis zu 4 Wohneinheiten, die vor dem 1. November 1977 gebaut wurden und nicht mindestens auf das Niveau der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 modernisiert wurden, ein Bedarfsausweis Pflicht.
Für neuere Gebäude oder bei mehr Wohneinheiten kann zwischen Verbrauchs- und Bedarfsausweis gewählt werden. Bei Neubauten ist ebenfalls ein Bedarfsausweis erforderlich – hier wird der theoretische Energiebedarf ja bereits in der Planungsphase berechnet.
Die Gültigkeit eines Energieausweises beträgt übrigens 10 Jahre. Danach muss ein neuer Ausweis erstellt werden.
Baujahr und energetischer Zustand des Gebäudes
Es gibt ‘ne Schlüsselrolle, die das Baujahr bei der Wahl des Energieausweises spielt. Warum? Die Wärmeschutzverordnung von 1977 markiert einen Wendepunkt in der deutschen Baugeschichte.
Bei Gebäuden, die vor 1977 gebaut wurden, ist grundsätzlich ein Bedarfsausweis erforderlich – es sei denn, sie wurden nachträglich auf das entsprechende Niveau modernisiert. Diese älteren Gebäude haben meist eine schlechtere Wärmedämmung als neuere Bauten.
Der energetische Zustand eines Gebäudes lässt sich an verschiedenen Faktoren ablesen:
- Dämmung von Dach, Außenwänden und Kellerdecke
- Qualität der Fenster (Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverglasung)
- Art und Alter der Heizungsanlage
- Nutzung erneuerbarer Energien
Wurden energetisch relevante Modernisierungen durchgeführt, kann dies die Wahl des Ausweistyps beeinflussen. Ich hatte einen Fall, wo ein Haus aus den 60ern komplett energetisch saniert wurde – hier war dann auch ein Verbrauchsausweis möglich, der die tatsächlichen Verbesserungen widerspiegelte.
Berechnung des Verbrauchsausweises: Daten und Methoden
Die Berechnung eines Verbrauchsausweises ist relativ unkompliziert, sofern die nötigen Daten vorliegen. Hier zählt, was tatsächlich verbraucht wurde – nicht was theoretisch verbraucht werden könnte.
Der Verbrauchsausweis gibt den tatsächlichen Energieverbrauch eines Gebäudes wieder und basiert auf den Heizkosten- und Energieabrechnungen der letzten drei Jahre. Das macht den Verbrauchsausweis günstiger und schneller zu erstellen als den Bedarfsausweis.
Zur Berechnung werden die verbrauchten Energiemengen erfasst, nach Witterung bereinigt und auf die Gebäudenutzfläche umgelegt. Das Ergebnis ist der Energieverbrauchskennwert aus dem Energieausweis in kWh/(m²·a) – also Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Energieverbrauchsdaten der letzten drei Jahre
Die Basis für jeden Verbrauchsausweis sind die Verbrauchsdaten der letzten drei Jahre. Diese Daten müssen vollständig sein, um ein realistisches Bild zu zeichnen.
Sie benötigen:
- Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre
- Nachweise über den Energieverbrauch für Warmwasser
- Bei selbstablesenden Eigentümern: Aufzeichnungen über Brennstoffzukäufe
Die Daten werden zunächst klimabereinigt, um Schwankungen durch unterschiedlich kalte Winter auszugleichen. Hierfür werden die Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes herangezogen.
Wichtig: Der Energieverbrauch für Warmwasser muss ebenfalls berücksichtigt werden. Wenn keine separaten Zähler vorhanden sind, wird der Energieverbrauch für Warmwasser pauschal auf Grundlage der Wohnfläche geschätzt.
Einfluss von Leerstand und Nutzungsverhalten
Leerstand und unterschiedliches Nutzungsverhalten können die Verbrauchswerte stark verzerren – ein Punkt, den viele übersehen.
Bei einem Leerstand von mehr als 4 Monaten innerhalb des dreijährigen Berechnungszeitraums darf kein Verbrauchsausweis mehr erstellt werden. Dann muss ein Bedarfsausweis her!
Das individuelle Heizverhalten beeinflusst den Verbrauch erheblich. Ein sparsamer Bewohner, der nur wenige Räume beheizt oder niedrigere Temperaturen bevorzugt, wird deutlich geringere Verbrauchswerte aufweisen.
Ich erinner mich an ein Mehrfamilienhaus mit identischen Wohnungen: Die Verbrauchswerte schwankten zwischen den Bewohnern um bis zu 300%! Das zeigt, wie stark das Nutzerverhalten den Energieverbrauchskennwert aus dem Energieausweis prägen kann.
Umrechnung in spezifischen Energieverbrauch
Nach der Erfassung und Klimabereinigung der Verbrauchsdaten erfolgt die Umrechnung in den spezifischen Energieverbrauch – den Energieverbrauchskennwert.
Die Berechnung läuft wie folgt ab:
- Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs in kWh für Heizung und Warmwasser
- Klimabereinigung der Werte
- Berechnung der Gebäudenutzfläche (Wohnfläche mit dem Faktor 1,2 bei Gebäuden mit bis zu 2 Wohneinheiten, sonst 1,35)
- Division des Gesamtenergieverbrauchs durch die Gebäudenutzfläche
Das Ergebnis ist der Endenergieverbrauch pro Quadratmeter und Jahr. Dieser Wert wird dann noch mit dem Primärenergiefaktor des jeweiligen Energieträgers multipliziert, um den Primärenergieverbrauch zu ermitteln.
| Energieträger | Primärenergiefaktor |
|---|---|
| Heizöl | 1,1 |
| Erdgas | 1,1 |
| Fernwärme (Mix) | 0,7-1,3 |
| Strom | 1,8 |
| Holz | 0,2 |
Der Verbrauch in Kilowattstunden wird letztendlich in die Skala der Energieeffizienzklassen von A+ bis H eingeordnet.
Berechnung des Bedarfsausweises nach GEG und EnEV
Im Gegensatz zum Verbrauchsausweis wird beim Bedarfsausweis theoretisch berechnet, wie viel Energie ein Gebäude unter Standardbedingungen benötigt. Hier braucht man deutlich mehr Daten zur Gebäudehülle und Anlagentechnik.
Der Bedarfsausweis basiert auf einer ingenieurmäßigen Berechnung des Energiebedarfs und berücksichtigt den Zustand des Hauses sowie die Heizungsanlage. Er ist unabhängig vom Nutzerverhalten und gibt ein objektiveres Bild vom energetischen Zustand der Immobilie.
Die Berechnung erfolgt nach normierten Verfahren, die im GEG (früher EnEV) festgelegt sind. Für Wohngebäude werden meist die DIN V 4108-6 und die DIN V 4701-10 verwendet, für Nichtwohngebäude die DIN V 18599.
Ermittlung des Endenergie- und Primärenergiebedarfs
Beim Bedarfsausweis werden zwei zentrale Werte ermittelt: der Endenergiebedarf und der Primärenergiebedarf.
Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die das Gebäude jährlich für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung benötigt. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche angegeben (kWh/(m²·a)).
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich den Energieaufwand für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des Energieträgers. Er wird berechnet, indem der Endenergiebedarf mit dem Primärenergiefaktor des jeweiligen Energieträgers multipliziert wird.
Die Berechnung des Endenergiebedarfs umfasst mehrere Schritte:
- Erfassung der Transmissionswärmeverluste (durch Wände, Fenster, Dach etc.)
- Berechnung der Lüftungswärmeverluste
- Berücksichtigung der solaren und internen Wärmegewinne
- Ermittlung des Nutzungsgrades der Wärmegewinne
- Berechnung des Heizwärmebedarfs
- Einbeziehung der Anlagenverluste (Erzeugung, Verteilung, Speicherung)
Berücksichtigung von Gebäudedaten und Anlagentechnik
Für einen Bedarfsausweis müssen zahlreiche Gebäudedaten und technische Details erfasst werden. Hier wird’s richtig detailliert!
Zu den relevanten Gebäudedaten gehören:
- Außenmaße des Gebäudes
- Flächen und Dämmwerte aller Bauteile (U-Werte)
- Fenstertypen und Verglasung
- Wärmebrücken
- Luftdichtheit
Bei der Anlagentechnik werden erfasst:
- Art und Effizienz der Heizungsanlage
- Speichersysteme
- Verteilverluste
- Regelungstechnik
- Lüftungsanlagen mit/ohne Wärmerückgewinnung
- Solarthermieanlagen
- Photovoltaikanlagen
Die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) spielen eine besondere Rolle. Sie geben an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Bei älteren Gebäuden sind diese Daten oft nicht vollständig dokumentiert. In solchen Fällen können Standardwerte für den entsprechenden Gebäudetyp und Baujahr herangezogen werden.
Die Rolle der Wärmeschutzverordnung von 1977
Die Wärmeschutzverordnung von 1977 stellt eine wichtige Zäsur im deutschen Baurecht dar. Sie legte erstmals verbindliche Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest.
Gebäude, die nach der Wärmeschutzverordnung von 1977 gebaut wurden oder deren energetischen Zustand durch Modernisierungsmaßnahmen entsprechend verbessert wurde, weisen in der Regel deutlich bessere energetische Eigenschaften auf als ältere Bauten.
Die Verordnung schrieb Mindest-Dämmwerte für verschiedene Bauteile vor und begrenzte den Heizwärmebedarf. Seitdem wurden die Anforderungen durch die EnEV und nun das GEG kontinuierlich verschärft.
Für die Energieausweis-Berechnung hat die Wärmeschutzverordnung von 1977 besondere Bedeutung: Sie bestimmt, welcher Ausweistyp gewählt werden kann. Für Gebäude, die vor 1977 gebaut wurden und nicht energetisch saniert wurden, ist ein Bedarfsausweis Pflicht.
Selbst bei meiner eigenen Altbauwohnung aus den 50ern war ich überrascht, wie deutlich sich die fehlende Dämmung im Bedarfsausweis niederschlug – trotz moderner Heizung landeten wir gerade mal in Klasse F!
Energieeffizienzklassen verstehen und Heizkosten berechnen
Die Energieeffizienzklassen im Energieausweis sollen auf einen Blick zeigen, wie energieeffizient ein Gebäude ist. Sie reichen von A+ (sehr effizient) bis H (energetisch schlecht).
Diese farbliche Darstellung – vom grünen Bereich bis zum roten – macht es einfach, den energetischen Zustand einer Immobilie einzuschätzen. Besonders für Laien ist diese Visualisierung hilfreich.
Anhand der Energieklasse können Sie grob abschätzen, mit welchen Heizkosten Sie rechnen müssen. Je höher der Energiebedarf oder -verbrauch, desto höher fallen in der Regel auch die Heizkosten aus.
Einteilung in Energieeffizienzklassen A+ bis H
Die Energieeffizienzklassen im Energieausweis strukturieren die Energiekennwerte übersichtlich. Seit 2014 gelten folgende Klassen:
| Energieeffizienzklasse | Primärenergiebedarf/-verbrauch in kWh/(m²·a) |
|---|---|
| A+ | < 30 |
| A | 30 bis < 50 |
| B | 50 bis < 75 |
| C | 75 bis < 100 |
| D | 100 bis < 130 |
| E | 130 bis < 160 |
| F | 160 bis < 200 |
| G | 200 bis < 250 |
| H | ≥ 250 |
Ein Passivhaus erreicht oft die Klasse A+ mit einem Wert unter 30 kWh/(m²·a). Moderne Neubauten liegen meist im Bereich A oder B. Unsanierte Altbauten landen häufig in den Klassen F bis H.
Die Klassen bieten Interessenten eine schnelle Orientierungshilfe. Immer mehr Immobilienanzeigen werben mit guten Energieeffizienzklassen – ein “A” macht sich halt besser als ein “G”.
Heizkostenabschätzung anhand der Energieeffizienzklasse
Mit Hilfe der Energieeffizienzklasse können Sie Ihre künftigen Heizkosten grob abschätzen. Das hilft bei Miet- oder Kaufentscheidungen.
Die Berechnung ist einfach:
- Energiekennwert aus dem Energieausweis (in kWh/(m²·a)) ablesen
- Mit der Wohnfläche multiplizieren
- Mit dem aktuellen Energiepreis (pro kWh) des jeweiligen Energieträgers multiplizieren
Beispiel: Eine 80 m² Wohnung mit Energiekennwert 120 kWh/(m²·a) und einem Gaspreis von 0,08 €/kWh würde jährliche Heizkosten von etwa 768 € verursachen (120 × 80 × 0,08 = 768).
Zu beachten ist: Beim Verbrauchsausweis kann die tatsächliche Energieverbrauch je nach Nutzerverhalten stark abweichen. Der Bedarfsausweis gibt theoretische Werte an, die in der Praxis oft überschritten werden, weil viele Bewohner mehr heizen als in der Norm angenommen.
Die Energieträger beeinflussen die Kosten ebenfalls stark. Ein Haus mit Klasse D kann mit Holzheizung günstiger sein als ein Haus mit Klasse C und Ölheizung.
So lesen Sie den Energieausweis richtig
Der Energieausweis enthält viele Informationen – aber wie liest man ihn richtig? Hier die wichtigsten Punkte:
Im Kopfteil finden Sie die Art des Ausweises (Verbrauchs- oder Bedarfsausweis), Ausstellungsdatum und Adresse des Gebäudes.
Der Energiekennwert (farbiges Balkendiagramm) zeigt den Endenergieverbrauch oder -bedarf. Dieser Wert ist entscheidend für die Einstufung in eine Energieeffizienzklasse.
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich die Umweltauswirkungen der verwendeten Energieträger.
Im Teil “Endenergie” wird aufgeschlüsselt, welche Energieträger verwendet werden (Gas, Öl, Strom etc.).
Die Vergleichswerte helfen, das Gebäude einzuordnen. Sie zeigen, wo ein durchschnittliches Gebäude steht und wo die Anforderungen für einen Neubau liegen.
Im Bereich “Erläuterungen” finden Sie Hinweise zur Berechnung und gegebenenfalls Einschränkungen bei der Interpretation.
Besonders wertvoll: Der Teil “Modernisierungsempfehlungen” enthält konkrete Vorschläge, wie die Energieeffizienz verbessert werden kann.
Ein Tipp aus meiner Praxis: Schauen Sie bei einem Verbrauchsausweis, ob die letzten drei Jahre überdurchschnittlich warm waren – das könnte zu geschönten Werten führen!
Rechtliche Anforderungen und Energieausweis-Pflicht bei Neubau und Modernisierung
Die Energieausweis-Pflicht ist gesetzlich fest verankert. Seit 2014 müssen Energieausweise bei Verkauf oder Neuvermietung nicht nur erstellt, sondern auch potenziellen Käufern oder Mietern vorgelegt werden.
Bei Neubauten ist der Energieausweis Bestandteil des Bauantrags. Hier werden bereits in der Planungsphase die energetischen Eigenschaften berechnet und nachgewiesen.
Auch bei umfassenden Modernisierungen kann ein neuer Energieausweis erforderlich werden – besonders wenn die Maßnahmen den energetischen Zustand des Gebäudes verbessern.
Pflichten gemäß GEG für Eigentümer
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert klare Pflichten für Immobilieneigentümer bezüglich des Energieausweises:
- Bei Verkauf oder Vermietung: Energieausweis spätestens bei Besichtigung vorlegen und bei Vertragsabschluss aushändigen
- Bei Immobilienanzeigen: Pflichtangaben aus dem Energieausweis (Energieeffizienzklasse, Energiekennwert, Baujahr, Energieträger)
- Bei Neubauten: Einhaltung der Mindestanforderungen an Energieeffizienz nachweisen
- Bei bestehenden Gebäuden: Nach Eigentumsübergang oder bei Neuvermietung einen gültigen Energieausweis bereitstellen
Für Nichtwohngebäude, die stark beheizt oder gekühlt werden und mehr als 250 m² Nutzfläche haben, gilt zusätzlich eine Aushangpflicht des Energieausweises an gut sichtbarer Stelle.
Das GEG schreibt außerdem vor, dass der Energieausweis meist vom Verkäufer oder Vermieter beschafft werden muss – nicht vom Käufer oder Mieter.
Ausnahmen und Besonderheiten bei Bestandsgebäuden
Nicht für jedes Gebäude gelten die gleichen Regeln. Es gibt einige Ausnahmen und Besonderheiten:
- Denkmalgeschützte Gebäude: Unter bestimmten Umständen von einigen Anforderungen befreit
- Kleine Gebäude: Gebäude unter 50 m² Nutzfläche sind ausgenommen
- Gewerblich genutzte landwirtschaftliche Gebäude: Spezielle Regelungen
- Provisorische Gebäude: Mit einer geplanten Nutzungsdauer unter zwei Jahren befreit
- Ferienhäuser: Die weniger als vier Monate pro Jahr genutzt werden, können ausgenommen sein
Bei Bestandsgebäuden mit weniger als 5 Wohneinheiten, die vor dem 1. November 1977 gebaut wurden und nicht mindestens auf das Niveau der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 modernisiert wurden, ist ein Bedarfsausweis Pflicht.
War letztens bei einer Beratung für ein altes Bauernhaus – dort hatte der Eigentümer einen Verbrauchsausweis erstellen lassen, was rechtlich gar nicht zulässig war. Das kann beim Verkauf richtig Ärger geben!
Konsequenzen bei Verstößen gegen die Energieausweis-Pflicht
Wer meint, die Energieausweis-Pflicht auf die leichte Schulter nehmen zu können, sollte die möglichen Konsequenzen kennen:
Verstöße gegen die Pflichten des GEG können als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern von bis zu 15.000 Euro geahndet werden. Dies gilt beispielsweise, wenn:
- Kein Energieausweis vorgelegt wird, obwohl gesetzlich vorgeschrieben
- Falsche Angaben im Energieausweis gemacht werden
- Pflichtangaben in Immobilienanzeigen fehlen
- Der Ausweis nicht vom berechtigten Personenkreis erstellt wurde
Neben den Bußgeldern drohen auch zivilrechtliche Konsequenzen. Käufer oder Mieter können bei fehlenden oder falschen Energieausweisen Schadensersatzansprüche geltend machen oder sogar vom Vertrag zurücktreten.
In der Praxis sehe ich immer wieder, dass besonders bei privaten Vermietungen die Energieausweis-Pflicht unterschätzt wird. Ein Interessent meldete sich mal bei der Behörde, weil ihm kein Ausweis vorgelegt wurde – das kostete den Vermieter nicht nur das Bußgeld, sondern auch den Mieter!
Wer eine Immobilie verkaufen oder vermieten will, sollte daher frühzeitig einen Energieausweis erstellen lassen und die gesetzlichen Vorgaben ernst nehmen. Die Kosten für einen Energieausweis sind im Vergleich zu möglichen Bußgeldern und rechtlichen Komplikationen vernachlässigbar.
Haben Sie alle gefunden, was Sie gesucht haben?
Super, haben Sie noch etwas zu ergänzen?
Was können wir noch verbessern? Helfen Sie uns Ihr Anliegen zu verstehen.
Das könnte Sie auch interessieren