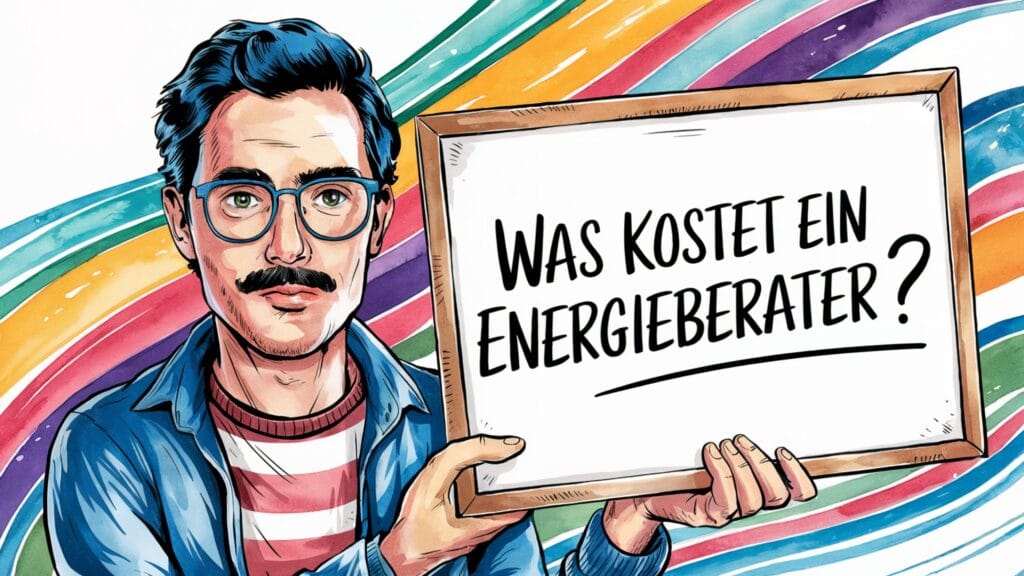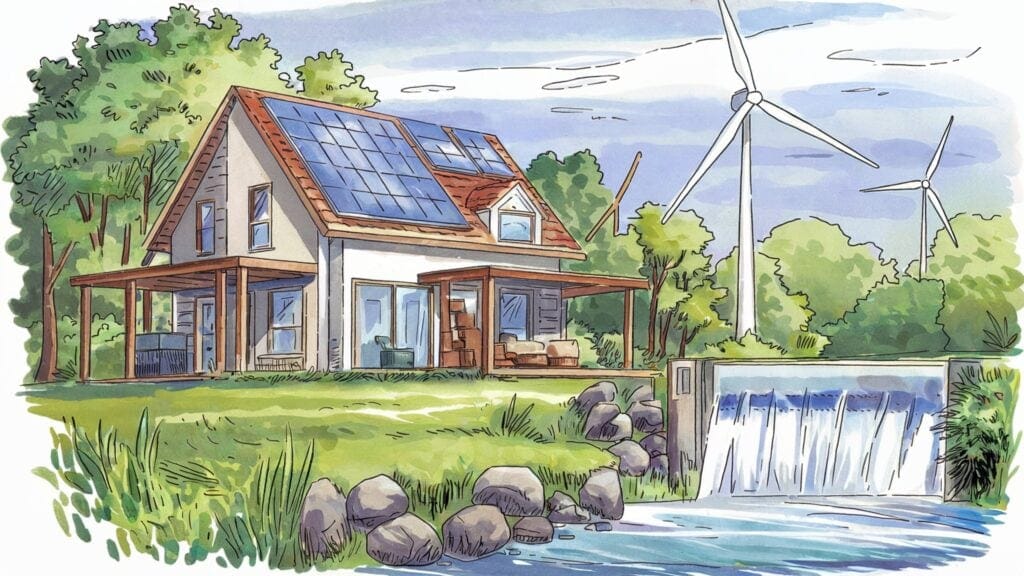Energetische Sanierung: Wann lohnt es sich und welche Förderungen gibt es?


Die energetische Sanierung von Immobilien gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt durch attraktive steuerliche Vorteile. Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat der Gesetzgeber klare Rahmenbedingungen geschaffen, die Hausbesitzer beim Klimaschutz unterstützen.
Durch gezielte Maßnahmen wie Wärmedämmung der Gebäudehülle, Fenstererneuerung oder die Installation moderner Heiztechnik können Sie den Energieverbrauch Ihrer Immobilie deutlich senken. Die staatliche Förderung durch KfW-Kredite, BAFA-Zuschüsse und steuerliche Absetzbarkeit macht die Investition in die Energieeffizienz besonders attraktiv. Ein qualifizierter Energieberater hilft Ihnen dabei, einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen und die für Ihr Gebäude optimalen Maßnahmen zu identifizieren.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Energetische Sanierungsmaßnahmen wie Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und neue Fenster können den Energieverbrauch um 15-76% senken und die Heizkosten deutlich reduzieren.
- Die Sanierung steigert den Immobilienwert und verbessert gleichzeitig den Wohnkomfort durch gleichmäßigere Temperaturen und ein besseres Raumklima.
- Zahlreiche Fördermöglichkeiten durch KfW, BAFA und steuerliche Vorteile können die Investitionskosten erheblich senken.
- Ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) und professionelle Energieberatung helfen bei der optimalen Planung und Koordination der Maßnahmen.
- Energetische Gebäudesanierungen tragen wesentlich zur CO₂-Reduktion bei und helfen, gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die kommende EU-Sanierungspflicht zu erfüllen.
Lohnt sich eine energetische Sanierung?
Eine energetische Sanierung ist weit mehr als nur eine Modeerscheinung im Bauwesen. Ich hab’s selbst erlebt: Als ich vor drei Jahren mein 70er-Jahre-Haus kaufte, war die Heizung praktisch ein Geldverbrennungsofen. Nach der Sanierung spare ich jetzt fast 60% der Heizkosten! Aber lohnt sich die Investition wirklich für jeden?
Die Antwort hängt von mehreren Faktoren ab: dem energetischen Zustand des Gebäudes, den aktuellen Energiekosten und natürlich den verfügbaren Fördermitteln. Eines steht jedoch fest: Mit steigenden Energiepreisen und strengeren gesetzlichen Vorgaben wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird die Frage nicht mehr sein, ob Sie sanieren, sondern wann und wie umfassend.
Energieverbrauch und Heizkosten senken
Der offensichtlichste Vorteil einer energetischen Sanierung liegt in der Reduzierung des Energieverbrauchs. Gerade bei älteren Wohngebäuden können Sie durch gezielte Sanierungsmaßnahmen besonders viel Energie einsparen. Undichte Fenster, schlecht gedämmte Dächer und veraltete Heizsysteme sind regelrechte Energiefresser.
Durch eine fachgerechte Dämmung der Gebäudehülle, den Einbau moderner Fenster und die Installation einer effizienten Heizung lassen sich die Heizkosten um 30 bis 70 Prozent senken. Das ist kein Marketingversprechen – unsere Kunden berichten regelmäßig von solchen Einsparungen.
Welche Einsparungen sind realistisch? Das hängt natürlich vom Ausgangszustand ab:
| Sanierungsmaßnahme | Typische Energieeinsparung | CO₂-Reduzierung |
|---|---|---|
| Fassadendämmung | 15-25% | bis zu 70 kg/m² jährlich |
| Dachdämmung | 10-20% | bis zu 50 kg/m² jährlich |
| Fensteraustausch | 5-15% | bis zu 30 kg/m² jährlich |
| Neue Heizung | 20-40% | bis zu 2 Tonnen jährlich |
Bei aktuellen Energiepreisen amortisiert sich eine Dämmung der obersten Geschossdecke oder Kellerdecke oft schon nach 4-7 Jahren.
Wertsteigerung durch Gebäudesanierung
Eine energetische Gebäudesanierung erhöht nicht nur die Lebensqualität, sondern steigert auch den Wert Ihrer Immobilie deutlich. In Zeiten, wo Energieeffizienz immer wichtiger wird, zahlen Käufer und Mieter gerne mehr für ein energieeffizientes Gebäude.
Studien zeigen, dass der Marktwert einer Immobilie durch eine umfassende Sanierung um bis zu 20% steigen kann. Der Energieausweis spielt dabei eine zentrale Rolle – er ist mittlerweile ein wichtiges Verkaufsargument geworden. Wohngebäude mit schlechter Energieeffizienzklasse verlieren dagegen zunehmend an Wert.
Außerdem ist zu bedenken: Ab 2030 müssen laut EU-Sanierungspflicht die energetisch schlechtesten Gebäude (Klassen F und G) saniert werden. Wer jetzt handelt, vermeidet späteren Zeitdruck und kann die bestehenden Steuervorteile optimal nutzen.
Positive Umweltbilanz erreichen
Die ökologische Dimension einer energetischen Sanierung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch die Senkung des Energieverbrauchs reduzieren Sie die CO₂-Emissionen Ihres Gebäudes erheblich.
Ein typisches Ein- und Zweifamilienhaus kann durch eine energetische Sanierung seinen Ausstoß um 4-6 Tonnen CO₂ pro Jahr reduzieren. Das ist mehr, als ein durchschnittlicher Pkw jährlich ausstößt! Wer zusätzlich auf erneuerbare Energien umsteigt, verbessert seine Umweltbilanz noch deutlicher.
Auch bei der Materialauswahl gibt es großes Potenzial: Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose speichern sogar CO₂. Wir raten immer dazu, bei der Planung auch die Ökobilanz der verwendeten Materialien zu berücksichtigen – hier kann ein qualifizierter Energieberater wertvolle Hilfe leisten.
Maßnahmen zur energetischen Sanierung
Es gibt nicht die eine perfekte Sanierungsstrategie, die für alle Gebäude passt. Jedes Haus hat seine eigene Geschichte und spezifische Schwachstellen.
Wärmedämmung der Gebäudehülle
Die Wärmedämmung der Gebäudehülle ist oft der erste und wichtigste Schritt bei einer energetischen Sanierung. Die Fassade, das Dach und die Kellerdecke sind dabei die Hauptansatzpunkte.
Bei der Fassadendämmung stehen verschiedene Systeme zur Auswahl. Am häufigsten wird das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) eingesetzt, aber auch vorgehängte hinterlüftete Fassaden sind eine Option. Die Dämmstärke sollte je nach Bauteil zwischen 14 und 20 cm liegen, um zeitgemäße Standards zu erreichen.
Die Dachdämmung bietet ein besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, da hier die Wärmeverluste besonders hoch sind. Je nachdem, ob das Dach bereits ausgebaut ist, kann zwischen einer Aufsparren-, Zwischen- oder Untersparrendämmung gewählt werden. Bei nicht ausgebauten Dachböden ist die Dämmung der obersten Geschossdecke oft die wirtschaftlichste Lösung.
Vergessen Sie nicht die Kellerdecke! Eine Dämmung von unten ist relativ einfach anzubringen und kostet wenig im Vergleich zur eingesparten Heizenergie. Bei einem unbeheizten Keller kann diese Maßnahme die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss um mehrere Grad erhöhen.
Moderne Heiztechnik installieren
Der Austausch einer veralteten Heizungsanlage ist ein Kernstück jeder sinnvollen energetischen Sanierung. Moderne Heizsysteme arbeiten wesentlich effizienter und verbrauchen deutlich weniger Energie.
Wärmepumpen sind derzeit die zukunftssicherste Lösung. Sie nutzen Umweltwärme aus Luft, Erde oder Grundwasser und wandeln diese mit Hilfe von elektrischer Energie in Heizwärme um. Bei guter Planung und Dimensionierung erzeugen sie das 3- bis 5-fache der eingesetzten Energie als Wärme.
Brennwertkessel sind eine weitere Option, wenn eine Wärmepumpe nicht möglich oder wirtschaftlich ist. Sie nutzen auch die Wärme des Wasserdampfs aus den Abgasen und erreichen so Wirkungsgrade von über 100% (bezogen auf den Heizwert).
Kombinieren lassen sich diese Systeme hervorragend mit thermischen Solarkollektoren, die insbesondere für die Warmwasserbereitung im Sommer fast kostenlose Energie liefern. Wichtig ist bei jeder neuen Heizung ein hydraulischer Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.
Fenster und Türen erneuern
Alte Fenster sind nicht nur undicht, sondern übertragen auch viel Wärme durch das Glas und den Rahmen. Der Austausch alter Fenster gegen moderne Modelle mit Dreifach-Verglasung reduziert die Wärmeverluste erheblich und verbessert zudem den Schallschutz.
Besonders wichtig ist der fachgerechte Einbau der neuen Fenster. Wärmebrücken entstehen häufig im Bereich der Anschlüsse zwischen Fenster und Wand. Die Fenster müssen von einem Fachunternehmen ausgeführt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Förderung zu sichern.
Der U-Wert moderner Fenster liegt bei etwa 0,8 W/m²K, während alte Isolierglasfenster oft Werte von 2,5-3,0 W/m²K aufweisen. Das bedeutet eine Reduzierung der Wärmeverluste um bis zu 70%! Auch bei Außentüren lohnt sich der Austausch gegen gut gedämmte Modelle.
Erneuerbare Energien nutzen
Die Integration erneuerbarer Energien ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Sanierungskonzepte. Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um, der entweder selbst genutzt, gespeichert oder ins Netz eingespeist werden kann.
Die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe ist besonders effizient. Der selbst erzeugte Strom kann direkt zum Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden. Mit einem Energiespeicher lässt sich der Eigenverbrauchsanteil deutlich erhöhen.
Auch Solarthermie-Anlagen haben ihre Berechtigung, besonders wenn sie zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Sie können bis zu 30% des jährlichen Wärmebedarfs decken. Bei der Planung erneuerbarer Energiesysteme ist es wichtig, die richtige Dimensionierung zu wählen, um ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.
Kosten und Förderung
Eine energetische Sanierung kostet Geld – keine Frage. Aber mit den richtigen Fördermitteln und steuerlichen Vorteilen wird sie deutlich erschwinglicher.
Kosten für die Sanierung kalkulieren
Die Kosten für eine energetische Sanierung variieren stark je nach Gebäudezustand, gewählten Maßnahmen und regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Orientierung:
- Fassadendämmung: 120-200 €/m²
- Dachdämmung: 150-250 €/m²
- Kellerdeckendämmung: 60-100 €/m²
- Fensteraustausch: 400-700 € pro Fenster
- Neue Heizung (Wärmepumpe): 15.000-25.000 €
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: 8.000-12.000 €
Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus (150 m² Wohnfläche) kostet eine umfassende Sanierung zwischen 70.000 und 150.000 €. Das klingt viel, doch bedenken Sie: Die Maßnahmen müssen nicht alle auf einmal durchgeführt werden. Ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) hilft, die Maßnahmen sinnvoll zu staffeln.
Wichtig: Kalkulieren Sie immer mit Puffern von 10-15%. Gerade bei Altbauten können unvorhergesehene Probleme auftauchen, die zusätzliche Kosten verursachen.
KfW-Förderung und BAFA-Zuschüsse
Die Förderbank KfW und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten attraktive Förderprogramme für energetische Sanierungen an. Das zentrale Programm ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).
Die KfW fördert sowohl Einzelmaßnahmen als auch Komplettsanierungen zu sogenannten Effizienzhäusern. Je besser der erreichte Standard, desto höher die Förderung. Für Einzelmaßnahmen gibt es Zuschüsse von bis zu 20% der förderfähigen Kosten.
Das BAFA konzentriert sich vor allem auf Heizungstausch und erneuerbare Energien. Beim Einbau einer Wärmepumpe sind Zuschüsse von bis zu 40% der Kosten möglich. Besonders gefördert werden Maßnahmen, die im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) umgesetzt werden – hier gibt es einen zusätzlichen Bonus.
Für beide Förderprogramme gilt: Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden, und die Arbeiten müssen von Fachunternehmen ausgeführt werden.
Steuerliche Vorteile nutzen
Seit 2020 können Eigentümer von selbstgenutzten Wohnimmobilien energetische Sanierungsmaßnahmen auch steuerlich geltend machen. Diese steuerliche Förderung ist eine Alternative zu den Programmen von KfW und BAFA – eine Kombination ist nicht möglich.
So funktioniert die steuerliche Förderung:
- 20 Prozent der Kosten können über drei Jahre von der Steuerschuld abgezogen werden
- Maximal 40.000 € pro Wohnobjekt förderfähig (also bis zu 8.000 € Steuerersparnis)
- Verteilung: 7% im ersten Jahr, 7% im zweiten Jahr, 6% im dritten Jahr
- Gilt für Gebäude, die älter als 10 Jahre sind
Förderfähige energetische Sanierungsmaßnahmen umfassen die Wärmedämmung von Wänden, Dach und Geschossdecken, die Erneuerung von Fenstern und Außentüren, den Einbau einer Lüftungsanlage sowie die Optimierung bestehender Heizungsanlagen.
Ein Vorteil der steuerlichen Förderung: Die Sanierungskosten steuerlich abzusetzen ist oft unbürokratischer als Zuschüsse zu beantragen. Die Nachweise werden einfach mit der Steuererklärung eingereicht. Allerdings müssen die Maßnahmen von einem Fachunternehmen ausgeführt werden und den technischen Mindestanforderungen entsprechen.
Planung und Energieberatung
Eine sorgfältige Planung ist das A und O bei einer energetischen Sanierung. Sie vermeidet kostspielige Fehler und stellt sicher, dass die Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt sind.
Energieberater beauftragen
Ein qualifizierter Energieberater sollte der erste Ansprechpartner für jede ernsthafte Sanierung sein. Er analysiert den energetischen Zustand des Gebäudes, identifiziert Schwachstellen und entwickelt passgenaue Lösungen.
Die Energieberatung selbst wird großzügig gefördert – bis zu 80% der Kosten werden vom BAFA übernommen. Diese Investition lohnt sich mehrfach: Studien zeigen, dass professionell beratene Sanierungen durchschnittlich 20% höhere Energieeinsparungen erreichen als solche ohne fachliche Begleitung.
Bei der Auswahl eines Energieberaters sollten Sie auf entsprechende Qualifikationen achten. Listen geeigneter Experten finden Sie bei der Deutschen Energie-Agentur (dena), dem BAFA oder der Verbraucherzentrale. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung speziell mit Ihrem Gebäudetyp.
Ein guter Energieberater berücksichtigt nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche Aspekte und bezieht Ihre persönlichen Prioritäten in die Planung ein. Er sollte unabhängig von Produktherstellern und ausführenden Firmen beraten.
Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)
Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) ist ein strukturiertes Konzept für die schrittweise energetische Modernisierung eines Gebäudes. Er berücksichtigt sowohl den aktuellen Zustand als auch das langfristige Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudes bis 2050.
Im iSFP werden die einzelnen Sanierungsmaßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge dargestellt. Das ermöglicht Ihnen, die Sanierung entsprechend Ihren finanziellen Möglichkeiten Schritt für Schritt anzugehen. Wichtig ist dabei, dass die einzelnen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und spätere Schritte nicht behindern.
Ein großer Vorteil des iSFP: Bei der Umsetzung der darin empfohlenen Maßnahmen erhalten Sie einen zusätzlichen “iSFP-Bonus” von 5% bei den Förderprogrammen von KfW und BAFA. Der iSFP selbst wird mit bis zu 80% gefördert und ist somit für Hauseigentümer sehr erschwinglich.
Der iSFP besteht aus drei Teilen:
- Einer Analyse des Ist-Zustands
- Einem Maßnahmenplan mit konkreten Empfehlungen
- Einer anschaulichen Umsetzungshilfe mit Hinweisen zur Förderung
Sanierungsmaßnahmen koordinieren
Die Koordination der verschiedenen Sanierungsmaßnahmen ist eine komplexe Aufgabe. Es geht nicht nur darum, die richtige Reihenfolge einzuhalten, sondern auch darum, die verschiedenen Gewerke aufeinander abzustimmen.
Grundsätzlich gilt: Zuerst die Gebäudehülle optimieren, dann die Anlagentechnik. Es macht wenig Sinn, eine neue Heizung zu installieren, wenn anschließend noch die Dämmung verbessert wird – die Heizung wäre dann überdimensioniert.
Eine professionelle Baubegleitung kann hier sehr hilfreich sein. Sie überwacht die Qualität der Ausführung, koordiniert die verschiedenen Handwerker und stellt sicher, dass alle Maßnahmen fachgerecht umgesetzt werden. Die Kosten für eine solche Baubegleitung werden ebenfalls mit bis zu 50% gefördert.
Besonders wichtig ist die Koordination bei der Dämmung der Gebäudehülle. Hier müssen die Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen sorgfältig geplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch bei der Integration erneuerbarer Energien ist eine gute Abstimmung mit der Heizungstechnik entscheidend.
Gesetzliche Vorgaben
Die energetische Sanierung wird nicht nur durch Förderungen attraktiver gemacht, sondern auch durch gesetzliche Anforderungen vorangetrieben.
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist seit November 2020 in Kraft und ersetzt die früheren Regelwerke EnEV, EnEG und EEWärmeG. Es bildet den rechtlichen Rahmen für energetische Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude in Deutschland.
Für Bestandsgebäude gibt das GEG Mindestanforderungen vor, wenn größere Renovierungen durchgeführt werden. Beispielsweise müssen bei der Erneuerung von mehr als 10% einer Bauteilfläche (z.B. Fassade oder Dach) bestimmte Dämmwerte eingehalten werden.
Auch für Heizungsanlagen gelten strenge Vorschriften: Öl- und Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind, müssen in der Regel ausgetauscht werden. Ab 2026 dürfen reine Ölheizungen grundsätzlich nicht mehr eingebaut werden, wenn nachhaltigere Alternativen zur Verfügung stehen.
Bei all diesen Vorgaben gibt es allerdings Ausnahmeregeln, insbesondere für denkmalgeschützte Gebäude oder wenn Maßnahmen wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Ein Energieberater kann hier helfen, die für Ihr Gebäude geltenden Anforderungen zu klären.
Energieausweis erstellen
Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er ist bei Verkauf oder Vermietung verpflichtend vorzulegen und gilt jeweils für 10 Jahre.
Es gibt zwei Arten von Energieausweisen:
- Den Bedarfsausweis, der auf einer technischen Analyse des Gebäudes basiert
- Den Verbrauchsausweis, der die tatsächlichen Verbrauchsdaten der letzten Jahre auswertet
Für eine energetische Sanierung ist der Bedarfsausweis aussagekräftiger, da er unabhängig vom Nutzungsverhalten der Bewohner ist. Er zeigt objektiv, wo die energetischen Schwachstellen des Gebäudes liegen.
Die Kosten für einen Energieausweis variieren je nach Gebäudegröße und Aufwand zwischen 150 und 500 Euro. Wird eine geförderte Energieberatung durchgeführt, ist der Energieausweis meist bereits enthalten.
Der Energieausweis klassifiziert Gebäude in Effizienzklassen von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient). Diese Einstufung wird zunehmend wichtiger für den Immobilienmarkt, da Käufer und Mieter verstärkt auf die energetische Qualität achten.
EU-Sanierungspflicht beachten
Die EU hat im Rahmen des “Green Deal” eine Gebäuderichtlinie verabschiedet, die schrittweise Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden einführt. Danach müssen die energetisch schlechtesten Gebäude (Klassen F und G) bis 2030 saniert werden.
Diese EU-Sanierungspflicht betrifft zunächst öffentliche und nicht-wohnwirtschaftliche Gebäude, wird aber schrittweise auch auf Wohngebäude ausgeweitet. Für Eigenheimbesitzer, die ihr Haus vor 2002 selbst bewohnen, gibt es allerdings Ausnahmen.
Die genaue Umsetzung in nationales Recht steht noch aus, aber die Richtung ist klar: Der Druck zur energetischen Sanierung wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Wer jetzt freiwillig saniert, kann noch von attraktiven Förderprogrammen profitieren und ist auf künftige Anforderungen bereits vorbereitet.
Obwohl manche diese Vorgaben kritisch sehen, haben sie doch einen wichtigen Effekt: Sie schaffen Planungssicherheit für alle Beteiligten und beschleunigen den notwendigen Umbau des Gebäudebestands, der für das Erreichen der Klimaziele unerlässlich ist.
Durchführung der Sanierung
Nach der Planung kommt die Umsetzung – und hier gibt es einige wichtige Faktoren zu beachten.
Fachbetriebe auswählen
Die Auswahl qualifizierter Fachbetriebe ist entscheidend für den Erfolg Ihrer energetischen Sanierung. Nur wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, erreichen Sie die berechneten Energieeinsparungen – und nur dann erhalten Sie die volle Förderung.
Achten Sie bei der Auswahl auf:
- Referenzen und Erfahrungen mit ähnlichen Projekten
- Spezifische Qualifikationen für energieeffizientes Bauen
- Mitgliedschaften in Fachverbänden
- Vollständige und detaillierte Angebote
Holen Sie stets mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Das günstigste Angebot ist nicht immer das wirtschaftlichste – Qualität und Erfahrung sollten Vorrang haben. Viele Fachbetriebe sind mit der Förderung vertraut und können Sie bei der Antragstellung unterstützen.
Für steuerliche Förderungen und KfW/BAFA-Programme müssen die Maßnahmen zwingend von einem Fachunternehmen ausgeführt werden. Der Betrieb muss eine Fachunternehmererklärung ausstellen, die bestätigt, dass die Arbeiten den technischen Mindestanforderungen entsprechen.
Qualitätssicherung der Arbeiten
Die Qualitätssicherung während der Bauphase ist ein oft unterschätzter Aspekt bei energetischen Sanierungen. Fehler in der Ausführung können die Wirksamkeit der Maßnahmen erheblich reduzieren.
Eine professionelle Baubegleitung durch einen qualifizierten Energieberater oder Bauingenieur kann hier sehr wertvoll sein. Sie überwacht kritische Arbeitsschritte, dokumentiert den Baufortschritt und stellt sicher, dass die geplanten energetischen Standards tatsächlich erreicht werden.
Besonders bei der Luftdichtheit des Gebäudes ist eine sorgfältige Ausführung wichtig. Mit einem Blower-Door-Test kann die Dichtheit der Gebäudehülle überprüft werden. Dieser Test wird oft als Nachweis für die Förderung verlangt und sollte frühzeitig eingeplant werden.
Auch Wärmebildaufnahmen (Thermografie) können helfen, Schwachstellen in der Dämmung oder Wärmebrücken aufzuspüren. Diese Methoden kosten zwar extra, sparen aber langfristig Geld durch höhere Energieeinsparungen.
Häufige Fehler vermeiden
Bei der energetischen Sanierung gibt es einige typische Fallstricke, die Sie unbedingt vermeiden sollten:
- Mangelnde Gesamtstrategie: Einzelmaßnahmen ohne übergreifendes Konzept können zu suboptimalen Ergebnissen führen. Lassen Sie immer einen Gesamtplan erstellen, auch wenn Sie nur schrittweise sanieren.
- Unterschätzte Lüftung: Nach einer Dämmung und dem Einbau dichter Fenster muss das Lüftungskonzept angepasst werden. Sonst droht Schimmelbildung durch erhöhte Luftfeuchtigkeit. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist oft die beste Lösung.
- Wärmebrücken übersehen: Ungedämmte Balkonanschlüsse, Rollladenkästen oder Fensterlaibungen können die Wirkung der Dämmung erheblich mindern. Achten Sie auf lückenlose Dämmkonzepte.
- Falsche Reihenfolge: Die Dämmung sollte vor dem Heizungstausch erfolgen, da sich der Wärmebedarf durch die Dämmung erheblich reduziert. Die neue Heizung kann dann kleiner dimensioniert werden.
- Fördermittel verschenken: Beantragen Sie Förderung immer vor Beginn der Maßnahmen und prüfen Sie alle Optionen. Oft ist eine Kombination verschiedener Programme möglich.
Ein weiterer häufiger Fehler ist die mangelhafte Dokumentation. Sammeln Sie alle Rechnungen, Produktdatenblätter und Fachunternehmererklärungen sorgfältig. Sie brauchen diese nicht nur für die Förderung, sondern auch später bei einem eventuellen Verkauf der Immobilie.
Nachhaltigkeit und Zukunft
Eine energetische Sanierung sollte nicht nur auf kurzfristige Einsparungen abzielen, sondern auch langfristige Nachhaltigkeit im Blick haben.
CO₂-Emissionen reduzieren
Private Gebäude verursachen rund 20% der deutschen CO₂-Emissionen. Eine energetische Sanierung kann diese Emissionen um 60-90% reduzieren – ein enormer Beitrag zum Klimaschutz.
Die größten Einsparungen erreichen Sie durch eine Kombination aus verbesserter Gebäudedämmung und dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Je nach Ausgangszustand können Sie die CO₂-Emissionen eines durchschnittlichen Einfamilienhauses von 6-10 Tonnen pro Jahr auf 1-2 Tonnen senken.
Mit dem CO₂-Preis, der seit 2021 auch für Heizenergie gilt und schrittweise steigt, wird die Emissionsreduktion auch finanziell immer attraktiver. Bis 2025 wird dieser Preis auf mindestens 55 Euro pro Tonne CO₂ steigen – ein weiterer Grund, jetzt in energetische Sanierungsmaßnahmen zu investieren.
Wer seinen ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren möchte, kann auch den Graue-Energie-Verbrauch berücksichtigen, also die Energie, die für Herstellung und Transport der Baumaterialien aufgewendet wurde. Hier haben natürliche Dämmstoffe oft Vorteile gegenüber konventionellen Materialien.
Ressourcenschonende Materialien einsetzen
Bei einer nachhaltigen Sanierung spielt nicht nur der spätere Energieverbrauch eine Rolle, sondern auch die verwendeten Materialien. Ressourcenschonende Baustoffe reduzieren die Umweltbelastung und verbessern oft auch das Raumklima.
Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle haben eine gute Ökobilanz und bieten gleichzeitig hervorragende bauphysikalische Eigenschaften. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Raumklima positiv beeinflusst.
Auch bei Fenstern und Türen gibt es nachhaltige Alternativen. Holz-Fenster haben eine bessere Ökobilanz als Kunststoff-Fenster und bieten bei richtiger Pflege eine ähnliche Lebensdauer. Moderne Holz-Alu-Fenster kombinieren die Vorteile beider Materialien.
Bei der Anlagentechnik sollten Sie auf hocheffiziente Geräte und langlebige Komponenten achten. Eine Solaranlage beispielsweise amortisiert ihren Herstellungsenergiebedarf in der Regel innerhalb von 1-3 Jahren und produziert dann über Jahrzehnte emissionsfreie Energie.
Innovative Technologien nutzen
Die energetische Sanierung profitiert von zahlreichen Innovationen, die sowohl die Effizienz als auch den Komfort erhöhen:
Smart-Home-Systeme ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung von Heizung, Lüftung und Beschattung. Durch intelligente Algorithmen können sie den Energieverbrauch weiter senken und gleichzeitig den Wohnkomfort erhöhen.
Hochleistungsdämmstoffe wie Aerogele oder Vakuumdämmplatten bieten bei geringer Dicke hervorragende Dämmwerte. Sie sind besonders bei begrenztem Platzangebot oder bei Innendämmungen interessant.
Phase-Change-Materialien (PCM) können Wärme oder Kälte speichern und zeitversetzt wieder abgeben. Sie verbessern den sommerlichen Wärmeschutz und können Heizenergie einsparen.
Gebäudeintegrierte Photovoltaik kombiniert Energieerzeugung mit architektonischen Funktionen. PV-Module können in Fassaden, Dächern oder sogar Fenstern integriert werden.
Der Trend geht zu Sektorenkopplung – also der Verbindung von Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor. Eine Wärmepumpe mit PV-Anlage und Batteriespeicher, kombiniert mit einer Wallbox für das Elektroauto, bildet ein integriertes Energiesystem, das den Eigenverbrauch maximiert und Netzlasten reduziert.
Diese innovativen Technologien werden kontinuierlich weiterentwickelt und immer erschwinglicher. Wer heute saniert, sollte die technologische Entwicklung berücksichtigen und zukunftsfähige Systeme wählen, die später erweitert oder angepasst werden können.
Haben Sie alle gefunden, was Sie gesucht haben?
Super, haben Sie noch etwas zu ergänzen?
Was können wir noch verbessern? Helfen Sie uns Ihr Anliegen zu verstehen.
Das könnte Sie auch interessieren